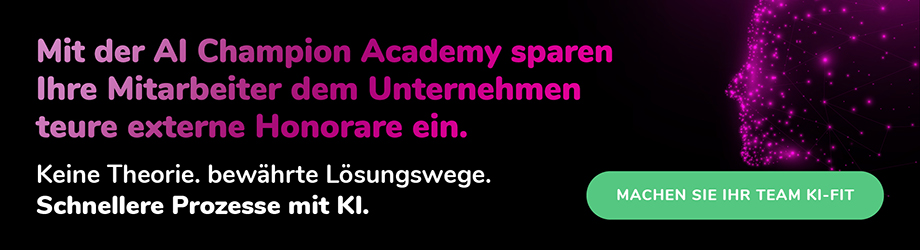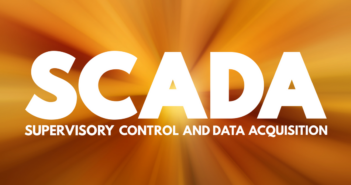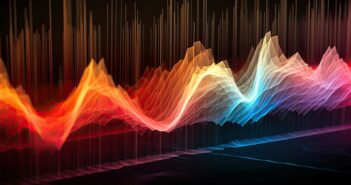Smart Building ist das intelligente Gebäude der Zukunft. Die Digitalisierung schreitet weiter voran, was auch den Komfort in Gebäuden verstärkt. Vieles kann nun automatisch ablaufen, was nicht nur Arbeit einspart, sondern auch Energiekosten senkt, beispielsweise wenn eine Heizung nicht unnötig hochheizt oder Lichter nicht ausgeschaltet werden. Mit der Digitalisierung schreitet auch die intelligente Gebäudetechnik voran.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Smart Building: Definition
Laut Smart Building Definition sind hier die technischen Anlagen und Bauteile miteinander vernetzt. Dabei wird häufig eine Schnittstelle zum Internet genutzt. So können die Prozesse auch außerhalb des Gebäudes gesteuert werden. Bei einem Smart Home sind einzelne Haushaltsgeräte, Licht und Wärme steuerbar. Bei einem Smart Building geht es viel mehr um eine intelligente Haustechnik. Diese kann zusätzlich mit Raum- und Geräteregelungen verbunden sein. Gebäude nach dem Prinzip des Smart Buildings sind mittlerweile der aktuelle Stand der Technik.
Der Begriff Smart Building stammt aus dem Englischen und bedeutet direkt übersetzt „intelligentes Gebäude“. Der Unterschied zum „Smart Home“, also dem intelligenten Zuhause, liegt bei der Digitalisierung eines gesamten Gebäudes, während sich das Smart Home lediglich mit intelligenten Wohnungseigenschaften beschäftigt. Bei einem Smart Building spielen die Automatisierung und die Kontrolle der technischen Ausstattung innerhalb eines Gebäudes eine zentrale Rolle. Der Grundbaustein eines Smart Buildings sind die vernetzten und fernsteuerbaren Geräte und automatisierte Abläufe. Ziel dabei ist neben einer komfortablen Bedienung von außerhalb auch eine effiziente Energienutzung für Kosteneinsparungen und eine positive CO2-Bilanz.
Was ist der Unterschied zwischen einem Smart Home und dem Smart Building?
Die Begriffe „Smart Home“ und „Smart Building“ werden oft synonym verwendet. Das ist allerdings nicht ganz richtig. Allerdings ist es auch nicht verwunderlich, da beide Begriffe ähnliche Ziele verfolgen, nämlich die Digitalisierung von Immobilien. Der entscheidende Unterschied beim Smart Building ist die Digitalisierung des gesamten Gebäudes, wie das Eigenheim oder Wohneinheiten in einem Mehrfamilienhaus sein.
Was ist ein Smart Home?
Das Smart Home ist Gesamtheit aller intelligenten Geräte in der Wohnung oder im Haus. Diese sind alle vernetzt und kommunizieren miteinander. Es sind jedoch eher einzelne Geräte in Wohnung oder Haus, welche beispielsweise ferngesteuert bedient werden können, wie etwa die Türschlösser, die per Handy entriegelt werden können. (Smart Lock)
Im Gegensatz zum Smart Building warten die Geräte auf die Anweisung vom Menschen. Sensoren werden vom Menschen bestenfalls aus der Ferne ausgelesen.
Ein gutes Beispiel sind vernetzte Kühlschränke, die Milch und Zucker bestellen. Aber auch Jalousien können es sein, die sich dem Sonnenstand anpassen.
Die Smart Meter zählen auch dazu. Hier ist es die Heizung, sie übermittelt ihren Zählerstand selbst direkt an den Energieversorger. Das Smart Home, steigert die Wohnqualität und senkt Betriebskosten.
Was ist beim Smart Building anders?

Die Temperatursteuerung in Reaktion auf Messwerte von Sensoren ist eine typische Smart Building Anwendung. (Foto: AdobeStock / Techtility Design 605820876)
Das Smart Building ist ein Gebäude, bei dem alle Haustechnik miteinander vernetzt ist. Das beginnt bei der Heizung, geht weiter über die Smart Meter, also die Stromzähler und Energiezähler bis hin zu Versorgungsleitungen für Wasser. Aber es kann auch die Steuerung für die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit enthalten sein, welche auf Sensoren reagieren und die Umgebung angenehm für die Menschen einstellen. Hier warten die Geräte auf die Anweisung von Steuerungen, welche auf Daten aus Sensoren reagieren.
Anders als im privaten Zuhause umfasst der Begriff „Smart Building“ den gesamten Bereich der intelligenten Vernetzung und Automation in Zweckgebäuden wie Bürogebäuden, Bahnhöfen und Shopping Malls. Die Zielsetzung der Vernetzung ist ähnlich: Mehr Komfort und weniger Energieverbrauch. Beim Smart Building kommt allerdings die Sicherheit ins Spiel, denn Cyberkriminelle haben durch die hohe Zahl an IoT-Systemen eine Vielzahl an Angriffspunkten, über die sie in das Smart Building eindringen und es kapern können.
Ähnliche Begriffe sind Smart Office, Smart City sowie PropTech
Smart Building Definition: „Smart Office“
Bei einem Smart Office werden intelligente Systeme genutzt, um das Büro effizienter zu gestalten. Hier verhilft die Digitalisierung dem Büro dabei den Arbeitsalltag mit vernetzten Technologien zu mehr Effizienz und Kostenersparnissen.
Smart Building Definition: „Smart City“
Auch in einer gesamten Stadt können Technologien zum Einsatz kommen, um Abläufe zu digitalisieren. Ist eine gesamte Stadt digital vernetzt, ist es eine Smart City.
Smart Building Definition: „PropTech“
Intelligente Anwendungen in der Wohnungswirtschaft werden durch sogenannte Property Technology (PropTech) Unternehmen realisiert. Mit der Unterstützung der jeweiligen Branche können Projekte der Digitalisierung von Immobilien gemeinsam vorangetrieben werden.
Siegeware: Wenn Hacker smarte Gebäude kapern
Explosive Bedrohung für Smart Buildings
Die zunehmende Vernetzung von Gebäudeautomatisierungssystemen hat Cyberkriminellen einen neuen Bereich für ihre Ransomware-Angriffe eröffnet. Anstelle von Computern und Smartphones nehmen sie nun ganze „Smart Buildings“ ins Visier. Diese neuartige Form der Erpressung, die als „Siegeware“ bezeichnet wird, nutzt die digitale Infrastruktur vernetzter Gebäude, um die Kontrolle zu übernehmen und verschiedene Systeme wie Stromversorgung, Aufzüge und Klimaanlagen zu manipulieren. Die Immobilienbesitzer werden gezwungen, ein hohes Lösegeld zu zahlen, um die Kontrolle zurückzuerlangen. Allerdings besteht keine Garantie, dass die Täter nach der Bezahlung tatsächlich die Kontrolle freigeben.
Realität statt Fiktion
Die Bedrohung durch Siegeware ist keine fiktive Annahme oder ein „Proof-of-Concept“, sondern bereits Realität. Ein Immobilienverwalter einer Gesellschaft, der für mehrere Gebäude in verschiedenen amerikanischen Städten verantwortlich ist, erhielt eine Erpressungsnachricht auf seinem Smartphone. Die Täter hatten sämtliche Kontrollsysteme in einem der medizinischen Kliniken gehackt und drohten damit, diese für drei Tage stillzulegen, es sei denn, innerhalb von 24 Stunden würden 50.000 Dollar in Bitcoin bezahlt.
Risiken der Fernsteuerung
Die zunehmende Automatisierung und Vernetzung von Gebäuden macht sie anfällig für Angriffe. Angreifer können relativ einfach die Building Automation Systems (BAS) über das Internet hacken und die vollständige Kontrolle über verschiedene Funktionen wie Temperaturregelung, Türschlösser, Alarme und Aufzüge übernehmen. Die Fernsteuerung bietet zwar Komfort und Kosteneinsparungen, birgt jedoch auch Gefahren, wenn sie nicht ausreichend abgesichert ist. Oftmals beschränkt sich der Zugangsschutz lediglich auf eine einfache Kombination aus Benutzername und Passwort, da zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen aus Kostengründen vernachlässigt werden.
Schwachstellen in der Sicherheit
Hacker-Angriffe auf Smart Buildings haben gezeigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen oft unzureichend sind. Die Verwendung von Benutzernamen und Passwörtern als einziger Schutzmechanismus ermöglicht es sogar durchschnittlich begabten Cyberkriminellen, erfolgreiche Angriffe durchzuführen. Moderne Sicherheitssysteme wie Security by Design, Abwehrmechanismen gegen Brute-Force-Angriffe oder eine Zweifaktor-Authentifizierung werden häufig aus Kostengründen vernachlässigt.
Auffinden von Opfern mit Shodan
Die Frage, wie Cyberkriminelle potenzielle Opfer finden, kann mit der Suchmaschine „Shodan“ (www.shodan.io) leicht beantwortet werden. Eine Suche nach „BAS“ im August 2021 ergab weltweit etwa 10.390 potenzielle Ziele, die über das öffentliche Internet erreichbar waren. Unter ihnen befanden sich 528 in Deutschland, 66 in der Schweiz und 54 in Österreich. Diese Informationen, inklusive IP-Adresse, SSL-Informationen und eingesetztem Router, erleichtern es Angreifern, anfällige Systeme zu identifizieren.
Fazit: Bedrohung ernst nehmen
Die Bedrohung durch Siegeware stellt eine ernste Gefahr für Smart Buildings dar. Die zunehmende Vernetzung und Automatisierung bieten Hackern neue Angriffsflächen, die oft unzureichend geschützt sind. Um diese Risiken zu minimieren, sollten Hersteller und Betreiber von Smart Buildings auf eine umfassende Sicherheitsarchitektur setzen, die den Schutz der Systeme und Daten gewährleistet. Zusätzliche Maßnahmen wie Security by Design, starke Zugangssicherung und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen sind unerlässlich, um die Kontrolle über Smart Buildings nicht den Händen von Cyberkriminellen zu überlassen.
25.09.2020: Martin Hron hackt sich über die Kaffeemaschine rein
Unter dem Titel „Der frische Geruch von Lösegeldkaffee am Morgen“ hat der Sicherheitsforscher Martin Hron vom renommierten Sicherheitssoftwarehersteller Avast schockierende Sicherheitslücken in smarten Kaffeemaschinen aufgedeckt. Mit seinem Experiment möchte er auf die potenziellen Risiken aufmerksam machen, die mit der Verwendung von vernetzten Geräten einhergehen.
Die morgendliche Tasse Kaffee ist für viele Menschen unverzichtbar, doch was passiert, wenn die vermeintlich intelligente Kaffeemaschine zum Sicherheitsrisiko wird? Genau das hat Hron gezeigt, indem er eine smarte Kaffeemaschine „Coffee Maker“ des Herstellers Smarter gehackt hat. Anstatt köstlichen Kaffee zu brühen, wurde der Besitzer mit einer schockierenden Lösegeldforderung konfrontiert. Ein bösartiger Teufel-Emoji starrte von dem Display, während heißes Wasser unkontrolliert aus der Espressomaschine spritzte.
Glücklicherweise handelte es sich bei der Lösegeldforderung um ein „Bastelprojekt“ von Hron und der Kaffeemaschinenbesitzer musste letztendlich kein Lösegeld bezahlen. Dennoch verdeutlicht dieser Vorfall die ernsthaften Sicherheitsmängel, denen smarte Geräte ausgesetzt sein können. Hron veröffentlichte seine Vorgehensweise und Erkenntnisse auf dem Avast-Blog „decoded“, um die Öffentlichkeit für die möglichen Gefahren zu sensibilisieren.
Die Sicherheitslücken in smarten Kaffeemaschinen sind nur ein Beispiel für die generelle Gefahr, die von vernetzten Geräten ausgeht. Hacker können sich Zugang zu Haushaltsgeräten verschaffen und diese für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Neben Kaffeemaschinen sind auch intelligente Thermostate, Türschlösser, Kameras und andere vernetzte Geräte potenzielle Einfallstore für Angriffe.
Die Risiken, die mit smarten Geräten verbunden sind, sollten nicht unterschätzt werden. Es ist essentiell, dass Hersteller von IoT-Geräten die Sicherheit ihrer Produkte verbessern und regelmäßige Updates bereitstellen, um bekannte Schwachstellen zu beheben. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bewusst mit vernetzten Geräten umgehen und sicherstellen, dass diese ordnungsgemäß geschützt sind.
Das Experiment von Martin Hron verdeutlicht eindrucksvoll die möglichen Konsequenzen einer unzureichenden Sicherheit bei smarten Kaffeemaschinen. Es ist ein Weckruf für die Industrie, die Sicherheit von IoT-Geräten ernst zu nehmen und umfassende Maßnahmen zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher zu ergreifen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir eine sichere und vertrauenswürdige vernetzte Zukunft gewährleisten.
Anforderungen an Smart Buildings
In Deutschland gibt es einige Anforderungen, damit ein Gebäude als Smart Building bezeichnet werden kann. So muss dieses beispielsweise energieeffizient sein und ein gesundes Wohnen ermöglichen. Das beinhaltet unter anderem, dass bei der Beheizung und Klimatisierung ein Mindestkomfort gegeben sein muss. Eine effiziente Technologie beim Heizen ist beispielsweise eine Wärmepumpe. Die Schnittstellen müssen dynamisch sein. Zudem muss das Smart Building auf die Bedingungen im Energiesystem reagieren können. Auch erneuerbare Energien müssen in das Smart Building aufgenommen werden können. Ist eine Photovoltaikanlage angebracht, sollte mit dieser gewonnenen Energie auch der eigene Strombedarf gedeckt werden. Intelligente Zähler können den Energieverbrauch und dessen Gewinnung problemlos und unkompliziert überwachen. Flexibilität entsteht hier durch Demand Response oder Strom- und Wärmespeicher.
Elemente eines Smart Buildings:
- Klimaanlage
- Pumpen
- Speicher
- Ventile
- Thermostat
- Lüftung
- Beleuchtung
- Schalter
Sensoren und Zähler:
- Mengenzähler
- Thermostat
- Beacons, Indoor-/Outdoornavigation
- Gegensprechanlage
- Kameras
- Gasmelder
- Bewegungsmelder
- Rauch- und Brandmelder
- Übertragungs- und Managementebene in Smart Buildings
Smart Buildings in Europa
Die Infrastruktur, die für eine Verbreitung von Smart Buildings notwendig ist, ist in Europa kaum gegeben. In Deutschland sind zwar mittlerweile viele Photovoltaikanlagen installiert worden, allerdings werden Kommunikations- und Informationstechnologien kaum genutzt. Hierzu zählen beispielsweise die intelligenten Zähler.
Energiewende und Smart Buildings
Die im Klimaschutz relevante Energiewende benötigt Konzepte wie Smart Buildings. Denn diese leisten einen großen Beitrag bei der Einsparung von Energien und arbeiten deutlich nachhaltiger. Das kommt nicht nur von den Photovoltaikanlagen, sondern auch durch die regulierbare Strom- und Wärmenutzung. Die Gebäudehülle ist auf die integrierten technischen Systeme abgestimmt, was für ein Höchstmaß an Effizienz sorgt. Vor allem die Energiespeicherung trägt ihren Teil zur Effizienz bei. So werden Nachfragespitzen reduziert. Produktion und Nutzung der erzeugten Energie können selbst gesteuert werden.
Auch in Sachen Komfort haben Smart Buildings einen deutlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Gebäuden. In der Regel ist das Raumklima deutlich besser. Smart Buildings können zudem als Schnittstelle zu anderen Bereichen des Energiesystems dienen. Ziel ist stets, die Energienachfrage von Gebäuden zu senken und gleichzeitig die selbsterzeugte Energie zu speichern.
Upgrade zu Smart Building
Oft sind es neue Gebäude, die direkt als Smart Building geplant und umgesetzt werden. Aber es ist auch möglich, bestehende Gebäude zum Smart Building aufzurüsten. Verschiedene technische Bausteine sind dabei nötig.
Diese Neuerungen sind zwar zunächst recht kostspielig, allerdings rechnen sich diese Systeme in der Regel schon nach wenigen Jahren. Die Digitalisierung eines Gebäudes umfasst das Innere als auch die IT-Netzwerke.
Technische Anlagen und Sensoren werden dabei miteinander vernetzt und kommunizieren miteinander. Dies kann über ein lokales Netzwerk als auch über eine Plattform für Datenaustausch realisiert werden. Management- und Monitoringwerkzeuge sind hierbei für die Überwachung sowie die Steuerung der Systeme wichtig.
Informationen und Daten werden dann zwischen den Ebenen des Smart Buildings ausgetauscht. Neben dem Begriff „Ebenen“ werden im Umfeld der Smart Buildings auch häufig „Layer“ oder „Area“ genutzt.
Wird ein bestehendes Gebäude zu einem Smart Building aufgerüstet, geschieht dies meist während einer Sanierung oder Modernisierung. Die Sensortechnik ermöglicht nicht nur die Überwachung der Funktionen und der Effizienz, sondern realisiert Prozesse auf drei Ebenen.
Der Gebäudeebene oder Feld- und Automatisierungsebene, also Technik, mit der das Gebäude ausgestattet ist. Der Übertragungsebene mit Funk, LAN und der Protokollierung und der Managementebene, welche Software, Plattform, Server und Cloudspeicherung beinhaltet.
Beispiele für die Nutzung auf Gebäudeebene
Mit der Gebäudeebene werden Anlagen und verschiedene Komponenten geregelt. Diese sind in einem Smart Building mit Datenpunkten versehen. Hier gibt es aktive und passive Komponenten.
-
Controller und Aktoren
sind aktive Bestandteile der Smart Buildings, während
-
Zähler und Sensoren
passive Bestandteile der Smart Buildings sind.
Diese dienen lediglich zur Erfassung von Daten. Ein Teil einer Anlage des Smart Buildings kann mit einem oder mehreren aktiven und passiven Komponenten ausgestattet sein. Die Übertragungsebene soll den Austausch von Informationen zwischen den einzelnen Komponenten eines Smart Buildings ermöglichen.
So werden beispielsweise die Gebäudedaten von einem Aktor zu einem Computer oder einem Sensor gesendet. Die technischen Möglichkeiten hierzu erweitern sich beständig. Zudem werden die Daten des Gebäudes an einen externen Ort gesendet. Dort können sie dann gesammelt und analysiert werden. Das Monitoring und die Auswertung der Gebäudedaten finden auf der Managementebene statt.
Hier werden die Funktionen und Prozesse überprüft und ausgewertet. Das macht ereignisbezogene Eingriffe möglich. So beispielsweise das Einwirken auf die Gebäudetechnik im Falle eines Brandes. Für diese Ebene werden Zugriffsrechte vergeben, um die Daten zu schützen und den Zugriff von außerhalb zu verhindern. Die Zugriffe können auch über das Internet von einem anderen Ort erfolgen.
Die verschiedenen Ebenen tauschen die Daten aus den Anwendungen aus. Allerdings sind offene Funkschnittstellen bei den Smart Buildings häufig problematisch. Sie können ein Datenschutz- und Sicherheitsrisiko darstellen. Zum Steuern und Regeln ist ein externer Zugriff auf die Gebäudeebene nicht zwingend erforderlich. Aus Sicherheitsgründen ist dies häufig auch nicht gewollt. Ist eine Steuerung von außen nötig, wird dies oft über einen VPN-Tunnel realisiert, so ist beispielsweise eine Fernwartung im Smart Building möglich.
Anwendungsfälle für Automation in Smart Buildings
Beispiele für Raumautomation
In einer Welt, die von digitalen Technologien geprägt ist, streben Unternehmen, Institutionen und sogar Privathaushalte nach immer intelligenteren und effizienteren Lösungen. Smart Buildings, auch bekannt als intelligente Gebäude, sind ein herausragendes Beispiel dafür, wie Technologie unsere physische Umgebung revolutioniert. Im Zentrum dieser bahnbrechenden Entwicklung steht die Raumautomation, eine fortschrittliche Lösung, die es ermöglicht, Räume intelligent zu steuern und zu verwalten.
Raumautomation umfasst eine breite Palette von Anwendungen und Funktionen, die darauf abzielen, den Komfort, die Sicherheit und die Energieeffizienz in Gebäuden zu verbessern. Von Bürokomplexen über Krankenhäuser bis hin zu Wohngebäuden bieten diese intelligenten Systeme eine Vielzahl von Anwendungsfällen, die den Alltag der Menschen erheblich erleichtern.
Dieser Artikel beleuchtet die faszinierenden Anwendungsfälle für Raumautomation in Smart Buildings. Wir werden einen Blick auf die Möglichkeiten werfen, wie diese Technologie den Arbeitsplatz optimiert, die Benutzerfreundlichkeit steigert und gleichzeitig einen nachhaltigen Energieverbrauch fördert. Darüber hinaus werden wir untersuchen, wie Raumautomation die Sicherheit erhöht und den Komfort in Wohngebäuden maximiert. Tauchen wir ein in die Welt der intelligenten Gebäude und entdecken wir, wie Raumautomation unsere Lebensräume in die Zukunft katapultiert.
| Anwendungsfall | Erforderliche Sensoren |
|---|---|
| Durch die Berücksichtigung von Präsenz und Fensterzuständen wird die Raumtemperatur auf individueller Basis effizient gesteuert. | Raumtemperatursensoren bzw.
Raumtemperaturregler, |
| In modernen Räumen werden Lüftung und Kühlung individuell an die Bedürfnisse angepasst. Dabei spielen Faktoren wie Lufttemperatur, Luftqualität und Luftfeuchte eine wichtige Rolle. Auch der Zustand der Fenster und die Anwesenheit von Personen werden berücksichtigt. | Raumtemperatursensor, Luftqualitätssensor, Luftfeuchtesensor, Präsenzmelder, Fensterkontakte, Drehgriffsensoren |
| Maßgeschneiderte Helligkeit: Raumindividuelle Dimmfunktion und Tastersteuerung bieten individuelle Lichtregelung | Taster, Helligkeitssensoren, Präsenzmelder |
| Sicherheitsmaßnahme: Jalousien und Rollläden an Terrassen- oder Balkontüren blockieren, solange die Türen nicht verschlossen sind. | Taster, Drehgriffsensoren, (Fensterkontakte) |
| Automatisierte Wärmeregulierung: Rollläden reagieren auf Raumtemperatur | Temperatursensoren, Präsenzmelder |
| Wetterbedingungen im Blick: Bei starkem Wind oder Sturm werden Jalousien und Markisen vorsorglich eingefahren, um eventuellen Schäden vorzubeugen. | Wetterstation (Windsensor) |
| Die Sicherung von Fenstern und Türen gewinnt angesichts der steigenden Bedrohung durch Einbrüche und unbefugten Zutritt an Bedeutung. Zudem bieten die Erfassung von Bewegungen im Außenbereich Möglichkeiten zur effektiven Beleuchtung und Alarmierung. | Fensterkontakte, AußenBewegungsmelder |
| Um Veränderungen wie Trennwände oder Möbeln gerecht zu werden, können die Taster für Beleuchtung und Verschattung an unterschiedlichen Positionen platziert werden. Einige Taster fungieren außerdem als Handsender. | Taster, Handsender |
| Die Messung des Energiebedarfs von einzelnen Verbrauchern ermöglicht eine präzisere Überwachung des Stromverbrauchs. | Stromzähler |
Beispiele für Anlagenautomation
Im Zeitalter der Digitalisierung und des Internet of Things (IoT) haben smarte Gebäude eine zunehmend wichtige Rolle in unserer modernen Gesellschaft eingenommen. Mit der fortschreitenden Entwicklung von Technologien zur Anlagenautomation eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, diese intelligenten Gebäude zu optimieren und effizienter zu gestalten. Die Anwendungsfälle für die Anlagenautomation in Smart Buildings sind vielfältig und reichen von der Energieeffizienzsteigerung über die Verbesserung des Raumklimas bis hin zur erhöhten Sicherheit und dem Komfort für die Bewohner. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der spannendsten Anwendungsbereiche, in denen die Automatisierung von Anlagen in smarten Gebäuden ihre volle Wirkung entfaltet. Erfahren Sie, wie diese Technologien unser tägliches Leben verbessern und zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen können.
| Anwendungsfall | Erforderliche Sensoren |
|---|---|
| Die Steuerung der Raumtemperatur sowohl für Heizungs- als auch Kühlungssysteme erfolgt heute präsenzabhängig und individuell auf den jeweiligen Raum abgestimmt. | Raumtemperatursensor bzw. Raumtemperaturregler, Präsenzmelder |
| Heiz- und Kältekreise werden bedarfsabhängig betrieben, wobei Aspekte wie Vorlauftemperaturen und Pumpenregelungen zukünftige Lasten berücksichtigen. | Temperatursensoren, Drucksensoren |
| Eine lastorientierte Prioritätensteuerung ermöglicht den Betrieb mehrerer Wärme- und Kälteerzeuger. | – |
| Heizungs- und Kälteanlagen werden ab sofort verriegelt, um einen gleichzeitigen Betrieb zu vermeiden. | – |
| In modernen Räumlichkeiten wird die Lüftung nun bedarfsgeführt gesteuert, abhängig von der Luftqualität und Luftfeuchte. | Luftqualitätssensor, Luftfeuchtesensor |
| Optimierte Lüftungsanlagen: Strategien zur Vermeidung von Vereisungen und Überhitzungen | Drucksensoren, Temperatursensoren |
| Durch die Aufzeichnung und Analyse von Daten werden Fehlermeldungen, Betriebsstunden und Energieverbräuche dokumentiert. | Diverse Analog-/Binäreingangssensoren, Strom- und Wasserzähler |
| Durch den Einsatz von Nachlüftung als günstige Option zur Gebäudekühlung können im Sommer aufgeheizte Räume effektiv gekühlt werden. | Raumtemperatursensor, Außentemperatursensor (bzw. Wetterstation) |